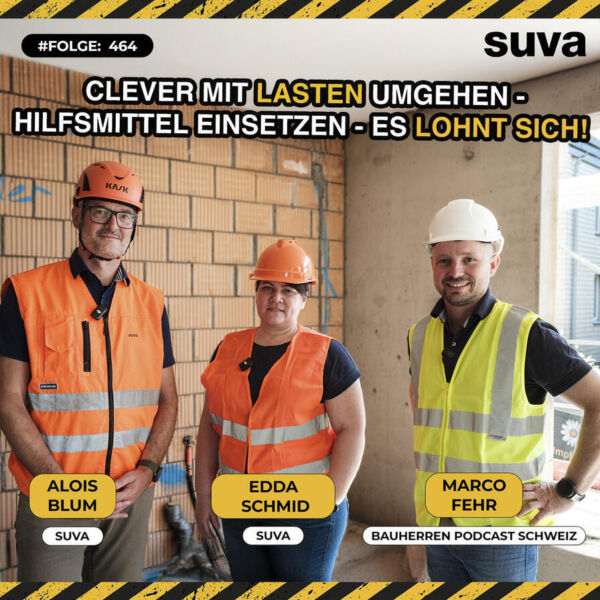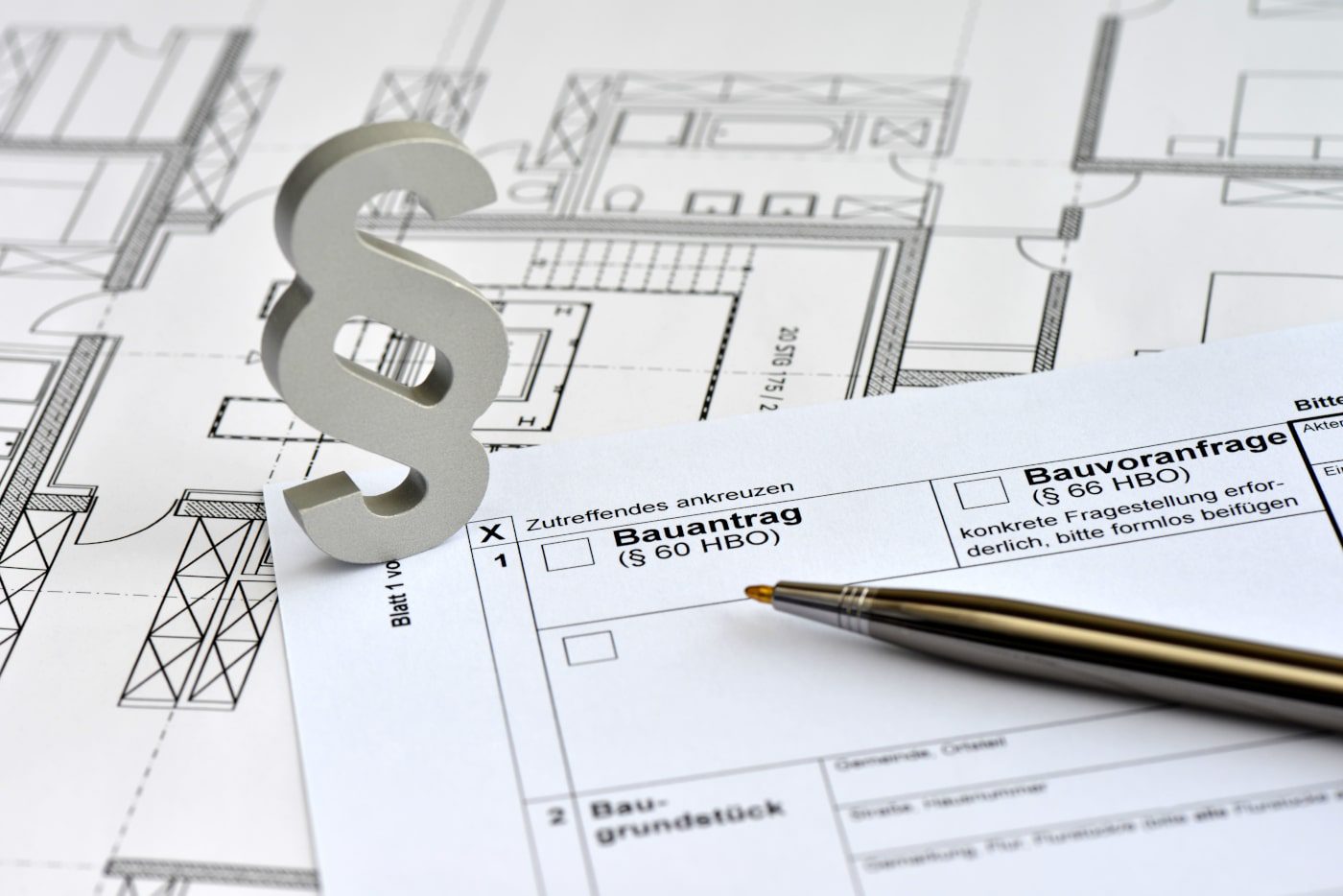
Baubewilligung: Wo man den Hebel ansetzen muss
Gut Ding will Weile haben – ein Sprichwort, das die heutigen Baubewilligungsverfahren in der Schweiz leider allzu genau beschreibt: Wer bauen will, muss warten können. 2010 hatte das Verfahren für den normalen Wohnbau rund 90 Tage gedauert. Heute sind wir mittlerweile bei 160 Tagen angelangt. Die Geduld der Bauenden wird also mehr und mehr auf die Probe gestellt. Hinzu kommt, dass der Antragsteller einen enormen Aufwand für die Baubewilligung betreiben und unzählige Dokumente vorbereiten muss. Zudem ist das Baubewilligungsverfahren in seiner heutigen Form intransparent: Was genau nach dem Einreichen der Dokumente geschieht und wie weit der Prozess ist, weiss man nicht. Für Manfred ist klar: Würden wir das Baubewilligungsverfahren etwas schneller, transparenter und mit weniger Ressourcenaufwand hinkriegen, würden alle davon profitieren.
Wünsche von Bauherren und Architekten
Äusserst wertvoll wäre es, wenn der Antragsteller selber im Voraus kontrollieren könnte, ob seine Dokumente korrekt sind. Ein Kantonsvertreter hat Manfred erzählt, dass er etwa bei der Kontrolle der Ausnutzungsziffer 80 % der Unterlagen retournieren muss. Frust pur – und zwar auf beiden Seiten. Die Behörden könnten ein Vorprüfungstool zur Verfügung stellen, wo man im Idealfall sein BIM-Modell hochladen und selbständig vorab Kontrollen durchführen könnte. Dies wäre beispielsweise für die Ausnützungsziffer, aber auch für den Brandschutz (Fluchtwege etc.) gut denkbar. Ein weiterer Wunsch ist mehr Transparenz. Ideal wäre es, wenn man vom Büro aus sehen könnte, wo sich die Baubewilligung befindet, welche Stelle gerade daran arbeitet, was geprüft wird und ob es Einsprachen gibt.Die grössten Herausforderungen
Auf dem Weg Richtung digitale Baubewilligung stehen noch einige Hürden. So müssten die Mitarbeiter, welche die Dokumente prüfen, den Umgang mit einer neuen Software erlernen, was bekanntlich nicht immer ganz einfach ist. (Diese Aufgabe könnte man theoretisch auch delegieren, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden.) Dann gilt es aber auch noch rechtliche Anpassungen vorzunehmen. In vielen Kantonen steht nämlich im Gesetz explizit, dass Papierpläne einzureichen seien. In anderen Ländern wie beispielsweise in Finnland, wo man diesbezüglich schon weiter ist (ab 2025 braucht dort jedes Bauprojekt ein Modell im IFC-Format), muss nur ein nationales Baugesetz geändert werden. Der schweizerische Föderalismus macht die Sache hierzulande etwas komplizierter. Nicht zuletzt haben die Nachbarinnen und Nachbarn das Recht, sich über das Bauprojekt zu informieren. Und denen kann man nicht bloss ein IFC-Dokument senden, das sie gar nicht öffnen können. Von der «Utopie» der digitalen Baubewilligung sind wir also leider noch weit entfernt. Doch das sollte einen nicht davon abschrecken, die Herausforderungen Schritt für Schritt anzupacken, findet Manfred. Genau das machen er und sein Team auch an der FHNW: Für die Gebäudeversicherung des Kantons Bern entwickeln sie aktuell eine digitale Lösung für den Nachweis des Brandschutzes.